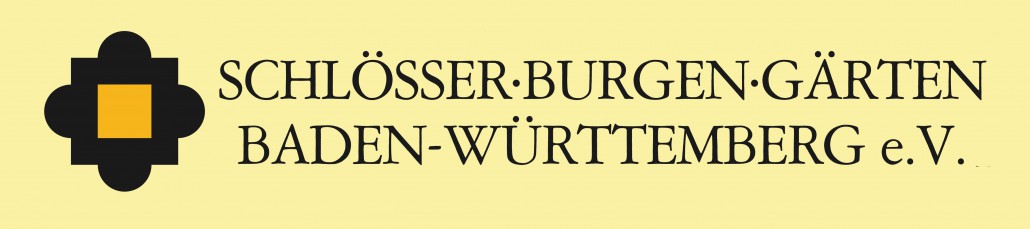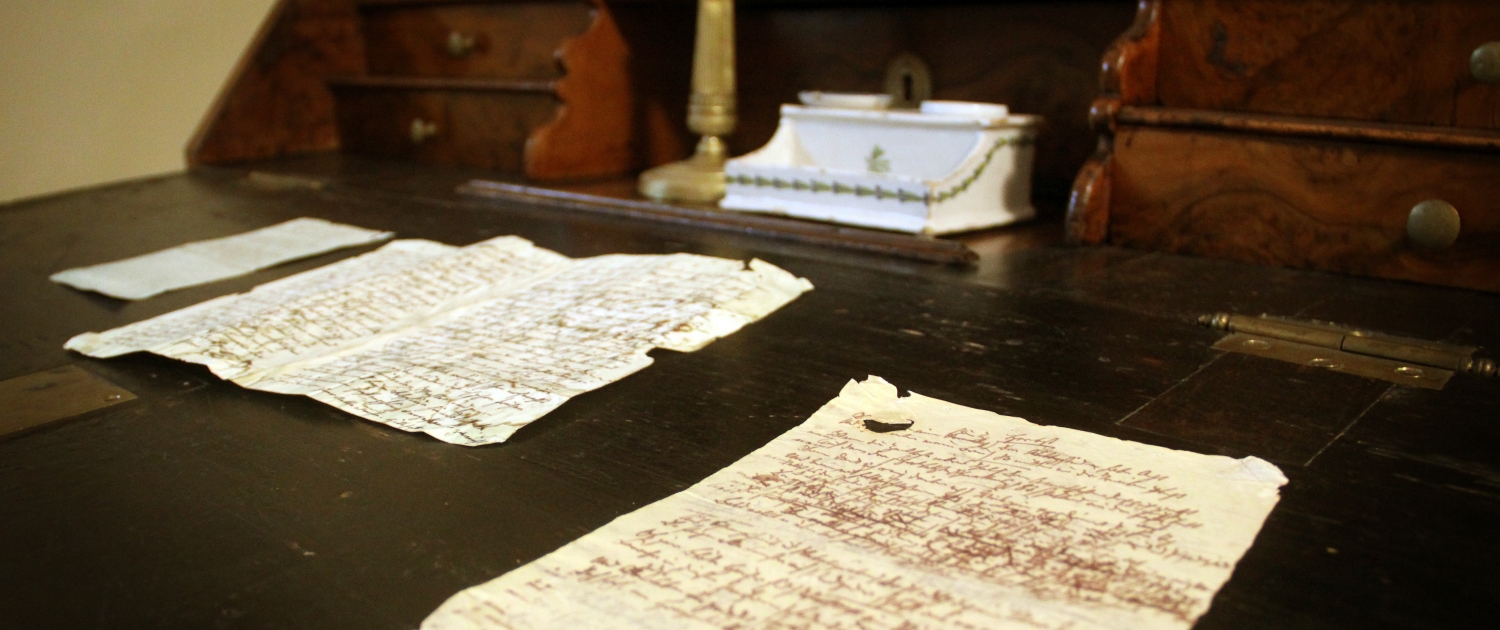Festungsruine Hohentwiel
Weitläufige neun Hektar groß ist die Festungsanlage, die der markante Berggipfel über Singen trägt. Sie gilt als eine der größten Festungsruinen Deutschlands: Ihre Verteidigungsmauern und Kasematten, ihre mächtigen Turmstümpfe und die großen Häuserruinen geben heute noch einen guten Eindruck davon, wie dieses Bollwerk noch im 18. Jahrhundert gewirkt haben muss. Und wer an einem schönen Tag bei einem Ausflug den Berg erklommen hat, wird mit einem imposanten Ausblick über den Hegau bis hin zum Bodensee und den Alpen belohnt.
Bau und Anlage
Die Festungsruine verfügt über eine ausgedehnten Vorhof und eine obere Festung. Letztere besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen: dem Schloss und der Kaserne mit Stallungen und Unterkünften, der sogenannte Lange Bau. Dazwischen erhebt sich die frühere Rossmühle, 1645 zur Kirche umgebaut. Der Kirchturm ist heute das noch am höchsten aufragende Gebäude. Die Kirche und der Lange Bau umschließen den Paradeplatz. Bis zu 30 Soldaten lebten hier im 16. Jahrhundert und bis zu 130 Mann im 18. Jahrhundert – in Kriegszeiten noch mehr. Und: Die meisten Soldaten hatten Familie. Der Vorhof dagegen enthielt alles Notwendige für die Versorgung der Burg: die Marketenderei – eine Art Kaufhaus –, eine Apotheke mit Arztwohnung, eine Bäckerei, eine Scheune, eine Kelter, Ställe, eine Wagenremise.
Die gewaltige Befestigungsanlage, die der Ingenieur Samuel von Herbort 1735 anlegte, sind heute noch an vielen Stellen zu sehen.
Eine besucherfreundliche Beschilderung liefert Informationen zu einzelnen. Orten der Festungsanlage.
Der Hohentwiel selbst, ein ehemaliger Vulkan, steht unter Naturschutz: Flora und Fauna des Berges weisen viele besondere Arten auf.
Im Informationszentrum führen didaktische Tafeln in die Geschichte und Natur des Hohentwiel ein. Mittelpunkt ist ein Modell, das die Festungsruine im Zustand des 18. Jh. zeigt. Zusätzlich finden Sie dort einen Museumsshop.
Geschichte
Die Festungsruine blickt auf eine sehr wechselvolle Geschichte zurück. Bereits im Jahr 914 entstand eine erste Burganlage. Als Sitz der schwäbsichen Herzöge erlangte die Burg Hohentwiel große Bedeutung; nach dem Jahr 1000 ging sie in den Besitz der Zähringer und dann gewöhnlicher Rittergeschlechter über. Seit dem 16. Jahrhundert war sie württembergische Enklave in vorderösterreichischem Gebiet. Herzog Ulrich von Württemberg ließ den Hohentwiel zur Landesfestung ausbauen. Der Stützpunkt galt nun als uneinnehmbar. Zu einem eher zweifelhaften Ruf gelangte die Festung im 18. Jahrhundert, als sie zum württembergischen Staatsgefängnis umfunktioniert wurde. 1801 schließlich wurde sie auf persönlichem Befehl des frsnzösischen Kaisers Napoleons geschliffen.
Dem Dichter Josef Victor Scheffel diente der Hohentwiel 1855 als Kulisse für den seinerzeit höchst populären Rom „Ekkehard“ – eine mittelalterliche Liebesgeschichte zwischen dem St. Gallener Mönch Ekkehard und der Herzogwitwe Hadwig.
Führungen / Familienprogramm
Zu Führungen s. bitte die Website.
Info-Zentrum barrierefrei; Ruine nicht barrierefrei
Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg
Festungsruine Hohentwiel
Auf dem Hohentwiel 2a
78224 Singen
Tel.: 07731.69178
E-Mail: info(at)festungsruine-hohentwiel.de
Öffnungszeiten
Saison: 1. April – 15. Oktober Mo. – So. / Feiertag von 9:00 – 18:30 Uhr letzter Einlass 17:30 Uhr
Winter: 16. Oktober – 31. März Di. – So. / Feiertag von 10:00 – 16:00 Uhr letzter Einlass 15:00 Uhr
Eintrittspreise
Burg
Erwachsene 5,00 €
Ermäßigte 2,50 €
Familien 12,50 €
Jahreskarte 25,00 €
Gruppen ab 20 Personen pro Person 4,50 €
Anfahrt
mit dem ÖPNV:
bis Bahnhof Singen-Landesgartenschau. Bitte die örtlichen Hinweisschilder beachten. Für Fahrzeuge über 3 m Höhe Zufahrt nur über Schaffhauser Straße.
Haltestelle Singen/ Hohentwiel
Kontakt
Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg
Festungsruine Hohentwiel
Auf dem Hohentwiel 2a
78224 Singen
Tel.: 07731.69178
E-Mail: info(at)festungsruine-hohentwiel.de
Fürstenhäusle Meersburg
Versteckt zwischen Weinstöcken liegt das Fürstenhäusle auf einer Anhöhe und bietet einen atemberaubenden Ausblick auf die Meersburger Altstadt und vor allem weit über den Bodensee bis hin zu den Alpen! Dieses um 1600 erbaute Kleinod war der schöpferische Rückzugsort der einst berühmten Dichterin Annette von Droste-Hülshoff. 1847 ersteigerte sie sich das Weinberghaus zusammen mit dem umliegenden Weinberg. Ihre, wie sie es in ihren Briefen beschrieb, „unschätzbare Perle“ ließ sie umbauen, um an ihrem Lieblingsort wohnen und schreiben zu können. Obwohl dieser Traum aufgrund ihres frühen Todes nicht in Erfüllung ging, ist es vorwiegend nach ihren in den Briefen überlieferten Vorstellungen eingerichtet.
Bau und Anlage
Die Dichterin Annette von Droste-Hülshoff beschreibt das Gebäude als „hübsches, massiv gebautes und bewohnbares Gartenhaus“. Es sei „ein kleines, aber massiv aus gehauenen Steinen und geschmackvoll aufgeführtes Haus, was vier Zimmer, eine Küche, großen Keller, und Bodenraum enthält.“
Die Aufteilung der Räume, wie sie Annette von Droste-Hülshoff beschrieb, ist bis heute im Wesentlichen gut nachvollziehbar. Im Erdgeschoss gab es zur Zeit der Droste das „Paradezimmer“ und eine Küche. Die Dichterin beschreibt in einem Brief das Paradezimmer „mit einem Erker, in dem der Kanapee mit Tisch und einigen Stühlen hinlänglich Raum haben… man sitzt dort wie in einem Glaskasten, ein Fenster im Rücken und zwey zu den Seiten“. Was heute im Raum den Blick anzieht, sind der Sekretär, das Tafelklavier und die biedermeierliche Einrichtung. Bilder zeigen die Dichterin, ihre Familie und ihren Freundeskreis. Zwei Vitrinen im Erker sind voller Sammlerschätze: Annette von Droste-Hülshoff liebte es, kleine Kostbarkeiten und Pretiosen zusammenzutragen. Münzen, Tücher, Porzellan, bestickte Beutelchen, Etuis, Ketten, Ringe, Kruzifixe, Rosenkränze, Mineralien und Muscheln.
Eine schlichte Holzstiege führt nach oben. Das zentrale Zimmer im Obergeschoss bezeichnete die Dichterin als “Dachshöhle” oder “Schwalbennest”. Es hat sieben Fenster, bietet viel Licht und einen grandiosen Ausblick. Es sollte der Dichterin als privater Rückzugsraum dienen: „Hieran stößt dann mein eigentliches Quartier, ein heizbares Wohnzimmer… und ein Schlafzimmerchen, grade groß genug für das Nöthige, Bett, Waschtisch, Schrank…“. In dem möblierten Raum hängen alte Ansichten Handschriftenfaksimiles, Miniaturporträts und Schattenrisse von ihr nahestehenden Personen. Außerdem sieht man hier historische Fotos der Nichten Hildegund und Hildegard von Laßberg, Illustrationen zu Gedichten der Droste, Tuschzeichnungen und Bilder weiterer Familienmitglieder und Bekannter.
Die Hör- und Medienstationen im Besucherraum geben einen lebendigen Einblick in ihr Leben und gesellschaftliches Umfeld. Hier kommen die Dichterin und Personen aus ihrem engsten Kreis selbst „zu Wort“.
Auch der Garten lädt den Besucher zum Verweilen ein. Das Panorama hatte schon damals die Dichterin ins Schwärmen gebracht: „Die Aussicht ist fast zu schön, d. h. mir zu belebt, was die Nah- und zu schrankenlos, was die Fernsicht betrifft“, schrieb sie begeistert ihrer Freundin Elise Rüdiger.
Geschichte
Das Fürstenhäusle wurde um 1600 für den Domherren Jakob Fugger, der kurz darauf zum Fürstbischof ernannt wurde, errichtet. Daher stammt auch der Name, unter dem das Gartenhaus weithin bekannt wurde. Bis zur Säkularisation 1802 nutzten die Konstanzer Fürstbischöfe das Rebhaus als persönliches Refugium. Im Jahr 1843 ersteigerte dann die berühmte Dichterin Annette von Droste-Hülshoff (1797–1848) das Rebhäuschen und nutzte es als ihren schöpferischen Rückzugsort.
Nach ihrem Tod ging das Fürstenhäusle zunächst an ihre Schwester Jenny von Laßberg und an ihre beiden Nichten Hildegund und Hildegard v. Laßberg. Später erwarben ihr jüngster Neffe Carl von Droste-Hülshoff und seine Frau Marie das Weinberghaus; sie wohnten dort bis 1922. Carl ließ zu Anfang des 20. Jahrhunderts an das bisherige Gebäude einen längeren Trakt anfügen und verlegte den Eingang. Das Haus wurde damit viel geräumiger als zu Zeiten der Dichterin. Heute befindet sich im Anbau das Besucherzentrum.
Carl von Droste-Hülshoff starb 1922 in Meersburg, im darauffolgenden Jahr richtete Marie in einem Teil des Fürstenhäusle das Droste-Museum ein. Nach dem Zweiten Weltkrieg übernahmen der Urgroßneffe der Droste, Heinrich Freiherr von Bothmer, und seine Frau Helen das Erbe. 1957 stiftete Letztere den Droste-Literaturpreis, den inzwischen die Stadt Meersburg alle drei Jahre an deutschsprachige Autorinnen vergibt. 1960 wurde das Fürstenhäusle an das Land Baden-Württemberg verkauft.
Führungen / Familienprogramm
Öffnungszeiten
Saison. 25. März – 5. November 2023 von 10:00 – 17:00 Uhr
Winter: Geschlossen
Eintrittspreise
Erwachsene 5,00 €
Ermäßigte 2,50 €
Meersburg-Card 4,50 €
Familien 12,50 €
Gruppen ab 10 Personen p.P. 4,50 €
Kombikarte Fürstenhäusle und Neues Schloss Meersburg: mit Meersburg-Card 7,20€
Anfahrt
Anfahrt mit dem öffentlichen Nahverkehr
Buslinien Ravensburg – Meersburg – Konstanz, Friedrichshafen – Meersburg – Überlingen/Konstanz
Die aktuellen Abfahrtszeiten erhalten Sie bei der bwegt-Fahrplanauskunft.
Parken
In ca. 750m Entfernung sind ausreichend öffentliche, kostenpflichtige Parkplätze für PKWs vorhanden.
Kontakt
Fürstenhäusle Meersburg
Stettener Straße 11
D-88709 Meersburg
Tel. +49 (0)7532 6088
info@fuerstenhaeusle.de
www.fuerstenhaeusle.de
Insel Mainau
Die wechselnde Blütenpracht das ganze Jahr über, der barocke Glanz von Schlossanlage und Kirche, das wertvolle Arboretum und eines von Deutschlands größten Schmetterlingshäusern machen die Mainau zu einem einzigartigen Erlebnis. Zu jeder Jahreszeit lohnt sich der Besuch auf die Insel Mainau. Architektonischer Mittelpunkt und prachtvolle Kulisse für verschiedenste Anlässe: das Deutschordensschloss. Hier schlägt das Herz der Insel, hier lebt Björn Graf Bernadotte mit seiner Frau Sandra Gräfin Bernadotte. Zu Ausstellungen, Veranstaltungen und im Bereich des Schlosscafés ist das Anwesen für das Publikum zugänglich.
Bau, Anlage & Geschichte
1739 bis 1746 wurde das Deutschordenschloss nach den Entwürfen Johann Caspar Bagnatos und unter seiner Bauleitung erbaut. Trotz beschränkter Finanzen entstand eine architektonisch höchst ausgewogene, symmetrische Schlossanlage von großer Harmonie. Hufeisenförmig öffnen sich die Arme der beiden Seitenflügel zum Festland. Dagegen ist die breite Seite dem See zugewandt. Das Gebäude ruht auf einem Sockel, über den sich zwei Stockwerke erheben. Prächtig am Westgiebel: die Wappen des Hochmeisters Clemens August von Bayern, des Landkomturs Philipp von Froberg und des Mainaukomturs Friedrich von Baden. Der Ostgiebel zur Seeseite trägt das Wappen des Deutschen Ordens.
Bagnato verzichtet in seinem Entwurf auf ein prächtiges repräsentatives Treppenhaus nach Würzburger Vorbild. Die Obergeschosse erreicht man über schlicht gehaltene Treppenhäuser in den Seitenflügeln.
Herzstück des Schlosses ist der ehemalige Audienzsaal, der in Weiß und Gold gehaltene sog. “Weiße Saal”, der sein heutiges Aussehen erst 1883 erhielt. Er ist nur zu Konzerten oder besonderen Veranstaltungen öffentlich zugänglich. Für das Publikum geöffnet im Rahmen wechselnder Ausstellungen ist auch der Wappensaal, zentraler Raum im Untergeschoss des ursprünglichen Corps de Logis. Dazu die Räume des Schlosscafés im Übergang zum Palmenhaus.
Schloss und Kirche bilden in ihrer klaren Architektursprache ein großartiges, harmonisches Ensemble – sie sind ein einzigartiges Beispiel süddeutschen Barocks.
Führungen / Familienprogramm
Öffnungszeiten
Ganzjährig von Sonnaufgang bis Sonnenuntergang
Eintrittspreise
24. Oktober 2016 bis 23. März 2017
Erwachsene: 9,50 €
Gruppenpreis (ab 10 Personen): 7,50 €
Schüler/-innen (ab 13 Jahren): 5,50 €
Studenten-/innen (mit Ausweis): 5,50 €
Kinder bis einschließlich 12 Jahren GRATIS
24. März 2017 bis 22. Oktober 2017
Erwachsene: 19,90 €
Gruppenpreis (ab 10 Personen): 15,70 €
Schüler/-innen (ab 13 Jahren): 11,50 €
Studenten-/innen (mit Ausweis): 11,50 €
Kinder bis einschließlich 12 Jahren GRATIS
Anfahrt
Die Insel Mainau im Bodensee befindet sich an einem der südlichsten Zipfel Deutschlands. Zu uns gelangen Sie auf vielfältige Weise: Mit dem Rad, Bahn und Bus, den Bodensee-Schiffen oder dem eigenen Fahrzeug. Die umweltschonendste Reisemöglichkeit mit dem Fahrrad unterstützen wir gerne und halten daher Schließfächer, eine Reparaturstation sowie Umkleidekabinen bereit.
Kontakt
Kloster und Schloss Salem
Kloster Salem zählt zu den schönsten Kulturdenkmälern am Bodensee. Das größte Zisterzienserkloster im süddeutschen Raum, zugleich lange Zeit Schloss der Markgrafen von Baden, präsentiert sich heute als historischer Ort voller Leben.
Bau und Anlage
Die Salemer Geschichte reicht weit zurück und alle Jahrhunderte haben eindrucksvolle Spuren hinterlassen. Bereits im Jahre 1134 gestiftet, gelangte das Kloster zu Reichtum und Macht. Deutlich ablesbar ist das heute noch an der Großartigkeit der Bauten, vom gotischen Münster bis zu den prachtvollen Barockbauten. Das Salemer Führungsprogramm stellt immer wieder die architektonischen und künstlerischen Höhepunkte aus den historischen Epochen in den Mittelpunkt: etwa den grandiosen Dachstuhl, noch im mittelalterlichen Originalzustand erhalten, die einzigartige Ausstattung des Münsters, oder das Leben des heiligen Bernhard von Clairvaux, dargestellt in den Barockmalereien im Kreuzgang.
Geschichte
Salem bietet ein anschauliches Bild von dem großen Reichtum, den die Zisterzienser durch eigene Arbeit und höchsten Schutz des Kaisers erwerben konnten. Das Münster, vom späten 13. bis zum frühen 15. Jahrhundert entstanden, gehört zu den letzten großen gotischen Bauten der Zisterzienser. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts wurden die Klostergebäude, die vielen Schlössern in nichts nachstehen, im barocken Stil neu erbaut. Berühmte Künstler arbeiteten ein Jahrhundert lang an der Ausgestaltung der Räume. Mit der Auflösung des Zisterzienserklosters gelangte Salem im 19. Jahrhundert in den Besitz der Markgrafen von Baden. Die von ihnen nach dem Ersten Weltkrieg gegründete Schule ist bis heute ebenso in Salem ansässig wie das Haus Baden selbst, das das Anwesen zum überwiegenden Teil im Jahr 2009 an das Land Baden-Württemberg verkaufte.
Museum/Ausstellungen
Klostermuseum und Feuerwehrmuseum
Seit September 2014 präsentiert ein neues Klostermuseum in der Prälatur mit einem neuen Zweigmuseum des Badischen Landesmuseums Karlsruhe wertvolle Exponate aus über 700 Jahren Kunst- und Baugeschichte des Klosters. Die historische Feuerwache im Entrée der Prälatur zeigt nicht nur zwei alte Handdruckspritzen aus der Barockzeit, sondern informiert auch über die innovativen technischen Leistungen der Zisterzienser bei der Wasserversorgung und beim Brandschutz.
Das neue Salemer Feuerwehrmuseum beim Sennhof präsentiert seine einzigartige Sammlung von Spritzen und Geräten – darunter echte Raritäten: historische Handdruckspritzen, Dampfspritzen bis hin zu Motorspritzen. Im Focus stehen auch die Pioniere des Feuerwehrwesens wie Kurtz, Metz und Magirus, die aus ihrem Leben „erzählen“
Führungen / Familienprogramm
Winter: 2. November – 24. März 2023 So./Feiertag 14:00 Uhr
Saison: 25. März – 1. November 2023 täglich
Kleine Führung
Dauer ca. 1 Stunde, keine Anmeldung erforderlich
Mo – So regelmäßig
Große Führung
Dauer ca. 1,5 Stunden, keine Anmeldung erforderlich
Mo – So regelmäßig
Themenführung „Weingeschichte(n)“
Rundgang durch das Kloster mit Speisesaal der Mönche, Kreuzgang, Kirche und Torkel
Fr./Sa./So. 11:00 Uhr ohne Voranmeldung
Kinder- und Familienführung
Dauer ca. 1 Stunde, keine Anmeldung erforderlich
So 15.00 Uhr
Öffnungszeiten
Winter: 2. November – 24. März 2023 Klostermuseum geöffnet
Saison: 25. März – 1. November 2023
Eintrittspreise
Erwachsene 11.-€
Ermäßigt 5,50€
Kinder (6-15Jahre) 5,50€
Familien 27,50€
Winterangebot
Klostermuseum geöffnet (Schloss geschlossen)
2. November 2021 bis 24. März 2023
Sa, So und Feiertage 11-16.30 Uhr
Am 24. und 31. Dezember hat das Klostermuseum geschlossen.
Winterführung nur an Sonn- und Feiertagen:
Schloss Salem – kleine Führung (Münster mit Chorgestühl, Kreuzgang und Sommerrefektorium) Dauer ca. 1 Stunde, keine Anmeldung erforderlich,
Treffpunkt am Klostermuseum nur an Sonn- und Feiertagen 14.00 Uhr (nicht am 24. und 31. Dezember)
Gruppenführungen nach Vereinbarung, auch außerhalb der Öffnungszeiten buchbar.
Winterpreise:
Klostermuseum € 5,–/Erwachsene, Kinder bis 15 Jahre frei
Sonn- und Feiertagsführung (inkl. Klostermuseum) € 7,–/Erwachsene, Kinder bis 15 Jahre frei
Anfahrt
Mit dem ÖPNV:
Im Stundentakt verbindet der Erlebnisbus in der Hauptsaison von 10.00 bis 17.00 Uhr Kloster und Schloss Salem mit dem Bahnhof Salem (Ortsteil Mimmenhausen) und dem Hafen von Unteruhldingen.
Kontakt
Führungen, Veranstaltungen und Informationen zu Kloster und Schloss Salem
Kloster und Schloss Salem
88682 Salem
Telefon +49(0)75 53.916 53 36
Telefax +49(0)75 53.916 53 34
schloss(at)salem.de
Neues Schloss Meersburg
Das Neue Schloss Meersburg thront über dem imposanten Blau des Bodensees. Als eine der originellsten Barockresidenzen hat sie seit ihrer Erbauung ab 1710 nichts an ihrer Schönheit eingebüßt und besticht noch heute durch ihre herrschaftliche Architektur und Ausstattung.
Bau und Anlage
Die Welt des barocken Hoflebens und seiner Pracht erleben: Das bietet ein Besuch im fürstbischöflichen Residenzschloss, das ab 1710 erbaut wurde. Schon das Treppenhaus beeindruckt mit seinen Statuen und dem prächtigen Deckengemälde. Balthasar Neumann lieferte den Entwurf, vollendet wurde es dann von Franz Anton Bagnato. Es führt zur Beletage mit den Privaträumen, den Staatsappartements und dem Spiegelsaal. Das Schlossmuseum zeigt darüber hinaus Exponate zur Jagd, Musik, zur Festkultur und ein Naturalienkabinett, das bereits im 18. Jahrhundert berühmt war.
Das Neue Schloss Meersburg begeistert durch seine originelle künstlerische Ausstattung – von besonderer Bedeutung sind dabei der Freskenmaler Giuseppe Ignazio Appiani und der Stuckateur Carlo Luca Pozzi. Die Deckenbilder im Treppenhaus und im Festsaal gehören zu den überragenden Arbeiten im Werk des deutsch-italienischen Barockmalers Giuseppe Ignazio Appiani (1706–1785), der von 1759 bis 1762 in Meersburg als Freskenmaler tätig war: Sie beeindrucken durch ihre Eleganz und Harmonie – und eine Prise Ironie. Durch den meisterhaften Stuckateur Carlo Luca Pozzi (1734–1812) aus dem Tessin bekam die Residenz der Fürstbischöfe ihre besondere Note: Das Schloss wurde schon damals für seine außergewöhnliche und amüsante Stuckausstattung bekannt. 1760 begann Pozzi seine Ausgestaltung des bezugsfertigen Neuen Schlosses. Die Stuckaturen zählen heute zu den schönsten ihrer Art in Baden-Württemberg. Sie zeigen religiöse, geschichtliche, sinnbildliche, höfische und alltägliche Bilder – meist höchst amüsant dargestellt.
Einen perfekten Ausklang des Schlossbesuches bietet die Terrasse mit der barocken Gartenanlage, einem eleganten Lustpavillon und dem beeindruckenden Panoramablick weit über den Bodensee bis hin zu den Alpen.
Geschichte
Anfang des 16. Jahrhunderts verlegten die Fürstbischöfe von Konstanz ihre Residenz aus dem protestantisch gewordenen Bischofsstadt nach Meersburg. 1710 lässt Fürstbischof Johann Franz von Stauffenberg, dem gesteigerten Repräsentationsbedürfnis des Barock entsprechend, die alte Burg um einen “Neuen Bau” erweitern. In den folgenden Jahren werden der einflügelige Bau mit Gartenparterre und Pavillon und das Priesterseminar (heute Droste-Hülshoff-Gymnasium) fertig gestellt. 1740 wird unter Fürstbischof Kardinal Damian Hugo von Schönborn der „Neue Bau“ als Schloss ausgebaut und um ein repräsentatives Treppenhaus erweitert. Der Baumeister Balthasar Neumann konzipierte den Umbau, vollendet wurde er aber letztendlich von Franz Anton Bagnato.
Nach fast 60-jähriger Bauzeit zieht der Fürstbischof von Rodt 1762 in das Neue Schloss ein. Unter ihm erhielt die barocke Fassade zum Schlossplatz hin ein zeitgemäßes Erscheinungsbild im Stil des Rokoko.
Auch ein Garten fehlte nicht in dieser fürstlichen Residenz. Bereits an der alten Meersburg hatte es einen auf einer Terrasse hoch über dem Bodensee gegeben. Das Neue Schloss wurde ebenfalls mit einem Lustgarten ausgestattet – die kleine Terrasse mit dem gelben Gartenpavillon ist heute noch erhalten!
Führungen / Familienprogramm
Zu Führungen und SOnderführungen s. bitte die Website.
Öffnungszeiten
Saison: 25. März – 6. November 2023 Mo. – So. / Feiertag von 9:30 – 18:00 Uhr
Winter: 7. November – 31. März 2024 Sa./So./Feiertag von 12:00 – 17:00 Uhr
http://www.neues-schloss-meersburg.de/besucherinformation/oeffnungszeiten
Eintrittspreise
Inklusive Audioguide
Erwachsene 6,00 €
Ermäßigte 3,00 €
Familien 15,00 €
Gruppen (ab 20 Personen) pro Person 5,40 €
Kombikarte: Neues Schloss und Fürstenhäusle Meersburg mit Meersburg-Card 7,20€
http://www.neues-schloss-meersburg.de/besucherinformation/preise
Gastronomie
Café im Schloss
Tel: +49(0)7532.807941-20
info(at)neuesschlossmeersburg.de
www.neuesschlossmeersburg.de
Öffnungszeiten:
Sommersaison:
täglich 9.00 bis 18.30 Uhr
Wintersaison:
Do-So 10.00 bis 18:30 Uhr
Kontakt
Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg
Neues Schloss Meersburg
Schlossplatz 12
88709 Meersburg
Telefon +49(0)75 32.80 79 41 0
Telefax +49(0)75 32.80 7 9 41 19
info(at)neues-schloss-meersburg.de
www.neues-schloss-meersburg.de
Neues Schloss Tettnang
Im Hinterland des Bodensees liegt eines der schönsten Schlösser in Oberschwaben. Ländliche Idylle mit Obst- und Hopfengärten prägt seine Umgebung. Das majestätische Barockschloss mit den luxuriös ausgestatteten Räumen zeugt vom Machtanspruch seiner Erbauer, der Grafen von Montfort.
Bau und Anlage
Symmetrische Vierflügelanlage von monumentaler Wucht
Geschichte
Hier wird noch an der Website gebaut
Führungen / Familienprogramm
Treppenhäuser, Korridore und Hof tagsüber frei zugänglich; Schlossmuseum nur im Rahmen von Führungen zugänglich
Öffnungszeiten
Dienstag – Sonntag 11.00 – 17.00 Uhr
Stündliche Führungen zur vollen Stunde, letzte Führung um 16.00 Uhr
Eintrittspreise
Erwachsene 7,00 €
Ermässigte 3,50 €
Familien 17,50 €
Gruppenführungen bis 20 Personen 126,00 €
jede weitere Person 6,30 €
Schulklassen bis 20 Personen 70,00 €
Kontakt
Neues Schloss Tettnang
Montfortplatz 1
88069 Tettnang
Tourist-Info Büro
Telefon +49(0)75 42 .51 05 00
Schloss Achberg
Das ehemalige Deutschordensschloss liegt im idyllischen Argental zwischen Wangen im Allgäu und Lindau am Bodensee. Historisch Wertvolles ist vor allem aus der Barockzeit erhalten. Beeindruckend ist der imposante Rittersaal mit einer der detailfreudigsten Stuckdecken Süddeutschlands. Von Frühjahr bis Herbst finden in den Räumen Kunstausstellungen und Konzerte statt.
Bau und Anlage
Das zurückhaltende Äußere des Deutschordensschlosses lässt kaum erahnen, welche Meisterwerke barocker Stuckateurskunst sich im Inneren befinden. Schloss Achberg ist ein Ort der Geschichte, ein lebendiges Kulturdenkmal und ein Ort der Begegnung mit hohem Freizeit- und Aufenthaltswert für Ausflügler, Wanderer, Radler und Touristen in der Region Allgäu-Bodensee-Oberschwaben.
Über die ursprüngliche mittelalterliche Wehrburg, die an der Stelle des heutigen Schlosses stand, ist nur wenig bekannt. Sie war Mittelpunkt und namengebender Sitz der Herrschaft Achberg. Eine “Burg zu Achberg” wurde 1335 erstmals schriftlich erwähnt. Die Ursprünge der heutigen Schlossanlage liegen im 16. Jahrhundert. Der Deutsche Orden erwirbt 1691 die Herrschaft Achberg. Käufer ist Landkomtur Franz Benedikt von Baden. Er lässt das Schloss von 1693 bis 1700 seiner adligen Lebensführung entsprechend prachtvoll ausbauen. Danach wird es still um Schloss Achberg. Bis 1805 nutzt der geistliche Ritterorden das Gebäude nur noch sporadisch. Heute ist das barocke Kulturdenkmal, gemeinsam mit dem Bauernhaus Museum Allgäu-Oberschwaben Wolfegg, ein Kulturbetrieb des Landkreises Ravensburg.
Führungen / Familienprogramm
Schloss Achberg bietet Ihnen in Form von Führungen, Workshops, Kursen und individuellen Veranstaltungen ein abwechslungsreiches, hochwertiges Begleitprogramm zu den Kunstausstellungen und vertiefte Einblicke in das Kulturdenkmal. Ein fantasievolles Kinderprogramm mit Konzerten, Kunstworkshops und Abenteuer Wildnis-Projekten auch die jüngsten Schlossbesucher. Das Schloss ist ein lebendiger Ort der Begegnung, mit vielen Veranstaltungen: https://www.schloss-achberg.de/vermittlung-workshops/
Ausstellungsführungen
an Sonn-und Feiertagen, jeweils um 14.30 Uhr
3 € / Person, zzgl. Eintritt
Schlossführungen
jeden 1. Samstag im Monat, jeweils um 14.30 Uhr
3 € / Person, zzgl. Eintritt
Museum/Ausstellungen
Für Kunstinteressierte werden auf den drei Stockwerken von April bis Oktober wechselnde Kunstausstellungen präsentiert. Zu sehen sind Werke aus vergangenen Epochen und Arbeiten zeitgenössischer Künstler. Das spannungsvolle Verhältnis zwischen den Kunstwerken und der barocken Architektur macht jeden Besuch zu einem besonderen Erlebnis. https://www.schloss-achberg.de/ausstellungen/
Öffnungszeiten
Eintrittspreise
Erwachsene 7 €, ermäßigt 6 €
Familien 13 €
Anfahrt
Adresse-Navi: Achberg, 88147 Duznau
Anfahrt von Lindau/Bregenz kommend fahren Sie auf der A 96 in Richtung Wangen an der Ausfahrt Weißensberg vorbei und nehmen nach ca. 4 km die nächste Behelfsausfahrt. Von hier links ab nach Achberg und zum ausgeschilderten Schloss.
Kontakt
Ihre Ansprechpartner/innen erreichen Sie im Landratsamt in Ravensburg:
Landkreis Ravensburg
Kulturbetrieb, Schloss Achberg
Gartenstraße 107
88212 Ravensburg
Telefon +49 751 85 9510
Telefax +49 751 85 9505
info@schloss-achberg.de
Schloss Heiligenberg
Gern wird es als Perle der Renaissance bezeichnet – Schloss Heiligenberg im Linzgau. Mehr als 700 m über dem Bodensee baute das Haus Fürstenberg einst die aus dem 13. Jahrhundert stammende Burg zu einem weitläufigen Renaissance-Schloss um. Bis heute unzerstört, ist es Wohnsitz des Erbprinzen Christian von Fürstenberg und seiner Familie. Bedeutende Schätze wie der holzgetäfelte Rittersaal oder die prächtig ausgestattete Kapelle können im Rahmen einer Führung besichtigt werden.
Bau und Anlage
Zwei Stockwerke des Südflügels nimmt der prachtvolle Rittersaal ein. Mit seiner kunstreich geschnitzten Holzdecke, dem korrespondierenden Parkettfußboden, den zahlreichen Ahnenporträts, Kabinettscheiben und Wappenbildern wird er von keinem Renaissancesaal nördlich der Alpen an Schönheit übertroffen. Von hier genießt man zudem eine Aussicht, wie sie eindrucksvoller nicht sein könnte. Bei klarem Wetter umfaßt der Blick die fruchtbare Landschaft zu Füßen des Schlosses, den gesamten Bodensee und die majestätische Schweizer Alpenkette. Auch die Schlosskapelle steht hinter dem Rittersaal kaum zurück. Sie ist zugleich ein wichtiges Denkmal der fürstenbergischen Familiengeschichte. Denn in der darunterliegenden Gruft befindet sich seit 1586 eine Grablege des Hauses. Hier ruht u.a. Fürst Max Egon II. (1863-1941), einer der engsten Freunde des letzten deutschen Kaisers Wilhelm II. Der Bildhauer Hans Wimmer hat für sein Grab ein archaisch anmutendes Kruzifix geschaffen. Es zählt zu den besonderen Kostbarkeiten des ohnehin mit Kunstwerken überreich geschmückten Renaissanceschlosses Heiligenberg.
Geschichte
Die Grafen von Fürstenberg errichteten Schloss Heiligenberg zwischen 1538 und 1584 an der Stelle einer mittelalterlichen Burg. Wenn es sich bis heute als eines der herausragenden Denkmale der deutschen Renaissance fast unverändert erhalten hat, so grenzt dies fast an ein Wunder. Im Dreißigjährigen Krieg hatten abziehende Söldnerhaufen bereits die Lunten an den Sprengladungen gezündet, um die gesamte Anlage zu sprengen. Auch die fortlaufenden Anpassungen an sich wandelnde Wohn- und Repräsentationsbedürfnisse blieben Schloss Heiligenberg weitgehend erspart. Denn die Schlossherren versahen zumeist hohe Ämter in kaiserlichen Diensten in Wien oder auch am Dresdner Hof Augusts des Starken.
Sie weilten deshalb stets nur kurzzeitig in Heiligenberg. 1716 starb gar die selbständige Heiligenberger Linie des Hauses Fürstenberg aus. Das Schloss wurde für viele Jahrzehnte kaum noch beachtet. So hat sich denn hier in wundervoller Lage oberhalb des Bodensees ein Kleinod der deutschen Renaissance fast unverändert erhalten.
Führungen / Familienprogramm
Führungen finden täglich (außer Montag) um 11.00 Uhr, 14.00 Uhr und 15.30 Uhr statt.
Sonderführungen für Gruppen können vereinbart werden.
Öffnungszeiten
Besichtigung nur mit Führung möglich
Öffnungszeiten
Ostersamstag – 31. Oktober
Eintrittspreise
10,00 €
Anfahrt
A81 Richtung Singen, Ak Kreuz Hegau von A81 auf A98 Richtung Überlingen, dann über Frickingen/Leustetten nach Heiligenberg
Bregenz -> Heiligenberg:
Von Bregenz (A) über Lindau (D), Friedrichshafen, Markdorf, Salem nach Heiligenberg
Friedrichshafen -> Heiligenberg:
Von Friedrichshafen über Markdorf, Salem nach Heiligenberg
Singen -> Heiligenberg:
A81 Richtung Stuttgart auf A98, Ausfahrt Stockach-Ost Richtung Überlingen, von Überlingen über Frickingen nach Heiligenberg
Parkplätze in ausreichender Anzahl stehen direkt im Schlosspark zur Verfügung.
Kontakt
Informationen & Buchungen
Tourist-Information Heiligenberg
Telefon: 07554- 998312
Telefax: 07554-998327
www.heiligenberg.de
Email: touristinfo@heiligenberg.de
Schloss Heiligenberg
Betenbrunner Straße
88633 Heiligenberg