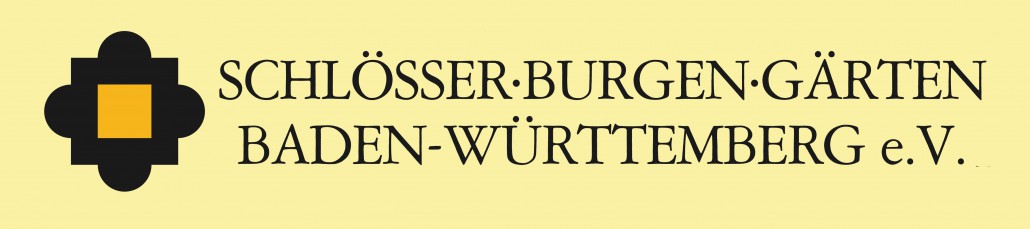Burg Wertheim
Am Zusammenfluss von Main und Tauber, hoch über der Wertheimer Altstadt erhebt sich mit der Burg Wertheim eine der größten Steinburgruinen Süddeutschlands. Die Ruine des mittelalterlichen Schlosses, die gleichzeitig das Wahrzeichen der Stadt Wertheim ist, zählt zu den beliebtesten Ausflugszielen zwischen Spessart und Odenwald.
Bau und Anlage
Imposante Ruine einer Höhenburg, errichtet auf ansteigendem felsigem Terrain, umgeben von einem tiefen Graben und wehrhaften Befestigungseinrichtungen; ursprünglich staufische Anlage mit Bergfried und Palas; später zur Wohnburg ausgebaute Vorburg
Geschichte
Zwischen 1180 und 1220 als staufische Burganlage errichtet, wurde sie im 15. Jahrhundert durch Bollwerke erweitert und in der Mitte des 16. Jahrhunderts zu einem Renaissanceschloss ausgebaut. 1619 wurde sie teilweise durch eine Pulverexplosion zerstört und im Dreißigjährigen Krieg stark beschossen. Heute ist die Burgruine im Besitz der Stadt Wertheim und zählt zu den beliebtesten Ausflugszielen zwischen Spessart und Odenwald.
Führungen / Familienprogramm
Die Burganlage kann auf einem weitläufigen Rundweg selbständig oder mit einer Burgführung nahezu komplett besichtigt werden.
Öffentliche Burgführungen sonntags 14.30 Uhr, Treffpunkt: Stiftskirche
http://www.tourismus-wertheim.de/stadtfuehrungen/burgfuehrungen.html
Öffnungszeiten
Eintrittspreise
Eintritt frei, erweiterter Rundgang (Drehkreuz-Eingang): 1 € pro Person
Veranstaltungen
Auch als eindrucksvoller Veranstaltungsort präsentiert sich die Burg Wertheim. Große Open-Air-Ereignisse wie Auftritte bekannter Musikmacher, Klassik- und Rockkonzerte finden auf der Burg ebenso statt wie Theateraufführungen, Kabarettveranstaltungen und Mittelaltermärkte. Auf der Burgterrasse werden regelmäßig Unplugged-Rock-Abende sowie Jazz-Frühschoppen angeboten.
Gastronomie
Genießen Sie den überwältigenden Blick auf die Flusslandschaften von Main und Tauber – zum Beispiel nach einem sportlichen Aufstieg zum Burgfried oder gemütlich auf der Terrasse des Burgrestaurants. Das Burgrestaurant selbst, bietet mit seinen verschiedenen Räumlichkeiten die Möglichkeit Feste im großen und kleinen Stil in der großartigen Kulisse der Burg Wertheim zu feiern.
Anfahrt
http://www.tourismus-wertheim.de/fileadmin/user_upload/pdf/Einkaufsfuehrer_Stadtplan.pdf
Kontakt
Stadtverwaltung Wertheim
Eigenbetrieb Burg
Mühlenstraße 26
97877 Wertheim
Tel. 09342/3010
Fax. 09342/301 500
www.burg-wertheim.com
Burg und Burgpark Gamburg
Die Gamburg ob der Tauber ist ein Kulturerbe von europäischem Rang. Ihre „Barbarossa-Fresken“ gelten als die ältesten weltlichen Wandmalereien nördlich der Alpen (um 1200) und die einzig erhaltenen Original-Ausmalungen eines Rittersaals. Die dargestellten Kreuzzugsszenen umrahmen dabei prächtige romanische Doppelarkaden. Die Burg wurde, auch dank ihrer Rettung durch Götz von Berlichingen im Bauernkrieg, nie zerstört und wird bis heute bewohnt. Sogar über 21 Geister sollen hier hausen. Der Barockpark mit Nymphenbrunnen entlang seiner Lichtachse ist als integraler Teil einer Burganlage in Deutschland einmalig. Das Café des statuengeschmückten Burghofs schmücken mediterrane Pflanzen. In der Kapelle und im Wappenzimmer finden Hochzeiten statt. Neben den regulären Führungen werden zahlreiche Veranstaltungen und Kurse angeboten.
Bau/Anlage und Geschichte
Die Gamburg ob der Tauber an der Romantischen Straße war im 12. Jahrhundert mainzisches Lehen und Residenz der Edelfreien von Gamburg. Ihr ursprünglich romanischer Saalbau gehört zu den außergewöhnlichsten des deutschen Hochmittelalters. Sein in Europa kulturhistorisch einzigartiger Hauptsaal trägt u.a. die sogenannten „Barbarossa-Fresken“, die ältesten weltlichen Wandmalereien nördlich der Alpen (um 1200). Diese einzig erhaltenen Original-Ausmalungen eines Rittersaals sind künstlerisch innovativ und zeigen großformatige Szenen des Kreuzzugs Kaiser Barbarossas sowie u.a. eine der frühesten Inschriften deutscher Sprache. Sie wurden 1986 zusammen mit außergewöhnlich prächtig geschmückten romanischen Doppelarkaden entdeckt. Der Saal selbst verfügte ursprünglich sogar über eine Fußbodenheizung. Seit 2001 ist die Gamburg als Nationaldenkmal gelistet.
Die seit ihrer Erbauung bewohnte Burg wurde in ihrer Geschichte, auch dank ihrer Rettung durch Götz von Berlichingen im Bauernkrieg, nie zerstört. Im Zusammenhang mit seiner Entführung des Amtmanns der Gamburg fiel sogar das berühmte „Götz-Zitat“. Seit 1546 befindet sich die Gamburg in adeligem Privateigentum.
Der Bergfried diente im 2. Weltkrieg als Archivbunker für Akten über die als „Rote Kapelle“ bekannten kommunistischen Widerstandsgruppen. Zeitweise aber auch als Wasserreservoir für den Burgpark.
Dieser auf einer künstlichen Terrasse angelegte Barockgarten mit seinem Nymphenbrunnen, seinem stimmungsvollen Lichtkonzept und seinen botanischen Raritäten ist als integraler Teil einer Burganlage in Deutschland einmalig. Seit den letzten Jahrzehnten wird er nach alten Vorlagen wiederbelebt und weiterentwickelt und profitiert vom besonders milden Klima des lieblichen Taubertals sowie den Ausläufern eines nahen Naturschutzgebietes.
Ebenso das Café des statuen- und wappengeschmückten Burghofs, dessen Palmen und andere exotische Pflanzen in der Saison mit herrlichen Düften ein mediterranes Flair verströmen.
Die Burgkapelle und das standesamtliche Wappenzimmer bieten einen wunderbaren Rahmen für Hochzeiten. Ebenso können Teile der Anlage für Tagungen, Feste u.ä. gemietet werden.
Im alten Waschhaus befindet sich der Burgshop „Zum Melusinenbad“.
Mit der Gamburg ist nämlich die Melusinensage der Gamburger Eulschirbenmühle sowie eine eigene Erzählung zu über 21 Geistern und weiteren Spukerscheinungen verbunden. Immer wieder wird dieses besondere Kulturdenkmal von Schriftstellern, Forschern oder Touristikern neu rezipiert.
Heute setzt sich die Eigentümerfamilie von Mallinckrodt für den weiteren Erhalt, die Erforschung sowie eine lebendige Kontinuität für die Zukunft der Gamburg ein. Burg und Burgpark können während der regulären Öffnungszeiten an jedem Wochenende und Feiertag der Saison besichtigt oder im Rahmen einer Führung besucht werden. Auf Anfrage sind Führungen auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich. Zudem werden zahlreiche Veranstaltungen und Kurse angeboten.
Führungen / Familienprogramm
REGULÄRE FÜHRUNGEN DURCH BURG UND BURGPARK
Während der Öffnungszeiten durchgehend ab 14 Uhr.
Letzte Führung um 17 Uhr.
Keine Voranmeldung nötig.
Bitte beachten Sie, dass der Rittersaal aus konservatorischen Gründen nur im Rahmen einer Führung besucht werden kann.
AUßERHALB DER ÖFFNUNGSZEITEN
Außerhalb der Öffnungszeiten sind Führungen jederzeit und ganzjährig auf Anfrage
unter 09348/605 oder mail@burg-gamburg.de möglich,
jedoch nicht unter 7 Personen oder 42,- €.
Die Führungen können auf Anfrage auch auf englisch oder französisch gehalten werden.
SCHULKLASSEN UND KINDERFÜHRUNGEN
Auf Anfrage werden spezielle Themenführungen für Schulklassen angeboten, die eigens auf die Vertiefung der Lehrpläne einzelner Unterrichtsfächer zugeschnitten sind. Daneben können auch allgemeine Kinderführungen sowie Kindergartenführungen gebucht werden.
Zu den diversen Sonderführungen siehe den Veranstaltungskalender unter www.burg.gamburg.de.
Regelmäßige Veranstaltungen
Neben den regulären Führungen bietet die Gamburg über das Jahr hinweg ein vielseitiges Programm mit zahlreichen Veranstaltungen und Kursen an. Zu den regelmäßigen Veranstaltungen gehören:
– Die biennale „Gamburger Burgweihnacht“ am dritten Adventswochenende
– Die monatlichen Sagen- und Geisterführungen
– Die sommerlichen Gartenveranstaltungen „L’apéritif au jardin“
– Die Kreativwochenenden
Einige dieser Veranstaltungen und Kurse können für Gruppen auf Anfrage auch jenseits der regulären Termine gebucht werden. Weitere Informationen sowie den jährlichen Veranstaltungskalender finden Sie unter www.burg-gamburg.de
Öffnungszeiten
REGULÄRE ÖFFNUNGSZEITEN
Vom 1. Aprilwochenende bis zum 1. Novemberwochenende
jeden Samstag, Sonntag und Feiertag
von 14.00 Uhr bis 18.30 Uhr.
Letzter Einlass um 17 Uhr.
Eintrittspreise
BESICHTIGUNG
Erwachsene: 3,- €
Schüler: 2,- €
FÜHRUNG
Erwachsene: 6,- €
Gruppen ab 20 Personen: 5,- €
Rollstuhlfahrer: 5,- €
Studenten: 5,- €
Schüler: 4,- €
Kindergartengruppen
ab 15 Personen: 3,- €
Ansonsten haben Kinder bis 6 Jahre freien Eintritt.
Gastromie
Café auf der statuengeschmückten Terrasse des Burghofs mit einer Auswahl köstlicher Kuchen, Kaffee oder sonstiger Getränke. Liegestühle unter dem großen Spitzahorn zwischen Palmen und weiteren mediterranen Pflanzen. Wunderbare Aussicht ins Taubertal.
Bei schlechtem Wetter wird das Burgcafé in das historische Wappenzimmer verlagert.
Anfahrt
An der Romantischen Straße, 30 km südwestlich von Würzburg.
Mit dem Auto:
Entweder über A3, Abfahrt Wertheim/Lengfurt, L2310 Richtung Urphar, dort links K2878, dann rechts K2824. Nach 5 km rechts K2821 Richtung Niklashausen, dort rechts L506.
Oder über A81, Abfahrt Tauberbischofsheim, B27 Richtung Tauberbischofsheim, dort L506 Richtung Wertheim.
Zufahrt und Parken: Die Burg ist, neben verschiedenen Rad- und Wanderwegen, über zwei Fahrwege erreichbar: Den Burgweg sowie den etwas steileren Hohlweg. Busse können die Burg über den Burgweg anfahren! Die Zufahrt endet ca. 70 m vor dem Burgtor. Dort gibt es auch entsprechende Parkmöglichkeiten. Ältere und Gehbehinderte können auf Anfrage direkt vor dem Burgtor abgesetzt werden. Alle Fahrer werden gebeten, im Ortsgebiet Gamburg langsam zu fahren und auf Anwohner zu achten.
Mit dem ÖPNV:
BAHN: Bahnhof Gamburg (Tauber) an der malerischen Taubertalbahn
BUS: Bus 941 der Strecke Lauda – Tauberbischofsheim – Wertheim
Kontakt
Burg und Burgpark Gamburg
Burgweg 29
97956 Werbach-Gamburg
+49 (0) 9348 605
mail(at)burg-gamburg.de
www.burg-gamburg.de
Deutschordensschloss Bad Mergentheim
Das zwischen Mergentheimer Altstadt und Kurpark gelegene Deutschordensschloss war ursprünglich ein Wasserschloss und wurde 1219 dem neu gegründeten Deutschen Orden geschenkt. Zunächst bevorzugte Residenz, wurde das immer weiter ausgebaute Schloss von der Reformation bis zur Säkularisation zum Hauptsitz des Ordens. Nach umfangreichen Sanierungen steht das Schloss mit dem Deutschordensmuseum heute wieder der Öffentlichkeit zur Verfügung.
Bau und Anlage
Das Schloss von Mergentheim, eine weitläufige Renaissanceanlage, war seit 1219 eine Niederlassung des Deutschen Ordens und 1525-1809 Residenz der Hoch- und Deutschmeister. Heute beherbergt es das Deutschordensmuseum auf rund 3000 m². An das Schloss schließen sich der Schlosspark und der Kurpark an. Einen Abglanz einstiger Deutschordensherrlichkeit spürt man in den fürstlichen Räumen des Schlosses. Die Mergentheimer Residenz wurde zwischen 1525 und 1809 von 18 Hochmeistern genutzt und immer weiter ausgebaut. Von dieser bewegten Baugeschichte zeugen aus der Romanik Staufische Palasarkaden, aus der Renaissance Berwarttreppe und Säulenhalle, vom Rokoko Götterzimmer und Neue Fürstenwohnung, vom Klassizismus Kapitelsaal und die Hauptstiege. Juwel der Residenz ist die Schlosskirche, zu deren Bau bedeutende Künstler wie Balthasar Neumann und François de Cuvilliès beigezogen wurden. In den 1990er Jahren wurde das Schloss grundlegend restauriert.
Geschichte
Der Deutsche Orden wurde 1190 während der Kreuzzüge als Spitalorden vor Akkon im Heiligen Land gegründet. Im 13. Jahrhundert wurde im Gebiet des späteren Ostpreußen ein mächtiger Deutschordensstaat errichtet. Seit dem 15. Jahrhundert verlor der Orden an politischer Bedeutung. 1809 wurde der Orden in Deutschland aufgehoben. Seitdem wird er von Wien aus geleitet. Er erneuerte sich und ist heute ein klerikaler Orden. 2009 wurde im Museum eine neue Abteilung eröffnet, die das Fortbestehen des Ordens bis heute präsentiert. Clemens August von Bayern, der Sohn von Kurfürst Max Emanuel von Bayern aus der Dynastie der Wittelsbacher, war Hoch- und Deutschmeister von 1732 bis 1761. Er war außerdem „Monsieur de Cinq Eglises“ (Herr von fünf Kirchen), d. h. Bischof und Landesherr in Köln, Münster, Osnabrück, Paderborn und Hildesheim. 1742 krönte er seinen Bruder Karl Albrecht in einer prunkvollen Zeremonie in Frankfurt a. M. zum Kaiser. In Bauten und Hofleben führte er das spätbarocke Lebensgefühl zu höchster Blüte. In der Residenz Mergentheim sorgte er für die Vollendung und Innenausstattung der 1736 eingeweihten Schlosskirche. Im Südflügel ließ er die neue Fürstenwohnung einbauen. Balthasar Neumann und Francois Cuvillies lieferten für beide Projekte Entwürfe. Nach Francois Cuvilliès wurde die Sala terrena als Gartenfesthaus angebaut. An das Spital im Stadtkern ließ er die St. Martins-Kapelle anbauen. Clemens August weilte zwar vermutlich nur 18 Mal in fast 29 Jahren als Hoch- und Deutschmeister in Bad Mergentheim. Aber er gestaltete die Residenz in Mergentheim nach zeitgenössischen Ansprüchen um, so dass seine Bauten und Einrichtungen noch heute den Eindruck vom Schloss prägen. Sein Verdienst ist es, dass bedeutende Künstler nach Mergentheim kamen und hier wirkten.
Führungen / Familienprogramm
Jeden Samstag, 15.00 Uhr: Museumsführung (1 h)
Jeden Sonn- und Feiertag, 15.00 Uhr: Führung „Der Deutsche Orden von 1190 bis heute“ (1h)
Jeden Donnerstag (April-Oktober), 15.30 Uhr: Kur/Kultur am Donnerstag, Führung für (Kur-)Gäste (1h)
Jeden ersten Samstag im Monat, 14.00 Uhr: Workshop für Kinder (6-10 Jahre), unterschiedliche Themen (1,5 h)
Jeden dritten Mittwoch im Monat, 15.00 Uhr: Angebot für SeniorInnen „Auf einen Schwatz ins Museum“, unterschiedliche Themen (1,5 h)
Jeden dritten Freitag im Monat (Mai-Oktober), 19.30 Uhr: Aufstieg auf den Bläserturm „Über 202 Stufen in den Himmel“ (1 h)
Jedes Jahr von Ostern bis Anfang Oktober: Führungsreihe „Schloss und Stadt“ in unregelmäßiger Folge zu verschiedenen Themen (1,5-2 h)
Die Führungen verbinden jeweils einen Museumsbesuch mit einem Gang durch die Stadt, durch den Park oder auf den Bläserturm.
Themen in Auswahl:
- „Verborgene Schätze und Kostbarkeiten in Stadt und Schloss“
- „In der Atmosphäre eines Palastes fühle ich mich wie ein wildes, eingekerkertes Wesen in einem goldenen Käfig… – Herzog Paul von Württemberg“
- „Augenschmaus und Gaumenfreude. Der Schlossgarten – Entstehung und Gegenwart“
- „Statthalter des Hochmeisters Maximilian I. in Mergentheim – Marquardt Freiherr zu Eck und Hungerspach“
- „Talentschmiede Mergentheim. Der Kunst auf der Spur“ Kostümführung „…all´ wuchen ein käß´… – die Türmerin Franziska Dermühl erzählt“
- „Mergentheim ist voller Engel!“
- „Hexen, Henker und Halunken – Gerichtswesen in Mergentheim“
- „Handel und Gewerbe in Mergentheim – Handwerker und Kaufleute in der Stadt“
- „Clemens August von Bayern. Hoch- und Deutschmeister (1732-1761). Ein famoser Barockfürst präsentiert sich“
- „Jüdisches Leben in Mergentheim. Was blieb übrig, was haben wir verloren?“ Kostümführung
- „`Auch ich trug einst der Liebe Müh und Lasten…` – Margarethe Mörike aus Mergentheim“ „Mergentheim im 19. Jahrhundert in den Augen von Eduard Mörike und anderen Dichtern“
Führungen zu besonderen Themen/Sonderausstellungen und Workshops zu Sonderaustellungen: siehe Infomaterial des Museums bzw. Kalender der Homepage http://www.deutschordensmuseum.de/veranstaltungen/
Außerdem Führungen nach Vereinbarung unter Tel. 07931/52212
Alle Führungen auch nach Vereinbarung zu buchen unter Tel. 07931/52212 oder per Mail an info(at)deutschordensmuseum.de
Öffnungszeiten
April – Oktober:
Dienstag – Sonntag/Feiertage 10.30 – 17 Uhr
November – März:
Dienstag – Samstag 14 – 17 Uhr
Sonntag/Feiertage 10.30 – 17 Uhr
Am 24./25. und 31. Dezember hat das Museum geschlossen
Eintrittspreise
Schloss
Erwachsene 6,- Euro
Ermäßigungsberechtigte 4,50 Euro
Kinder unter 6 Jahre frei
Kinder/Jugendliche bis 17 Jahre 2,00 Euro
6,- Euro Erwachsene
4,50 Euro Ermäßigungsberechtigte
5,- Euro p. P. bei Gruppen ab 20 Personen
5,50 Euro Kurgäste mit Kurkarte
freier Eintritt für Kinder unter 6 Jahren
2,- Euro Kinder/Jugendliche (6 – 17 Jahre)
Führungen
2,- Euro pro Person zzgl. zum Eintrittspreis
Gruppenführung
42,- Euro zzgl. Eintrittspreis (nach Anzahl der Personen)
Bitte beachten Sie, dass jeweils nur eine Ermäßigung möglich ist.
Regelmäßige Veranstaltungen
- Teilnahme am Schlosserlebnistag für Familien
- Literatur im Schloss
- Museumskonzerte
Gastronomie
Das Schloss grenzt unmittelbar an die Altstadt, wo in 3-5 Gehminuten Cafés, Gaststätten und Restaurants sowie Hotels aller Kategorien erreichbar sind.
Anfahrt
Mit dem Auto:
Bitte nehmen Sie als Anhaltspunkt für die Eingabe in ein Navigationssystem die Kapuzinerstraße. Sie führt direkt zum Schloss. Vor dem Schloss ist eine verkehrsberuhigte Zone. Am besten parken Sie im Parkhaus Altstadt/Schloss (5 Min. Fußweg zum Museum) oder auf dem Parkdeck hinter dem Schloss (2 Min. Fußweg).
Zwei Anfahrtsskizzen finden Sie hier.
Der Eingang zum Deutschordensmuseum liegt im Inneren Schloßhof. Wenn Sie von der Altstadt Richtung Schloss-/Kurpark gehen, kommen Sie durch den Roten Torbau des Schlosses in den Äußeren Schlosshof. Hier halten Sie sich rechts, Richtung Schlosskirche. Sie gehen durch die Durchfahrt bei der Schlosskirche in den Inneren Schlosshof. Dort finden Sie wiederum rechterhand den Eingang ins Deutschordensmuseum.
Mit dem Fahrrad:
Das Deutschordensmuseum liegt am Radweg “Liebliches Taubertal”.
Mit dem ÖPNV:
Vom Bahnhof Mergentheim ist das Museum in 7-10 Minuten Gehzeit zu erreichen. Linien 956, 957, 958 – Haltestelle Marktplatz
Kontakt
Deutschordensmuseum Bad Mergentheim GmbH
Geschäftsführerin Maike Trentin-Meyer M. A. (Museumsdirektorin)
Schloss 16
97980 Bad Mergentheim
Tel. 07931/52212
Fax 07931/52669
info(at)deutschordensmuseum.de
www.deutschordensmuseum.de
Grafschaftsmuseum Wertheim
Hier wird noch am Website-Schloss gebaut.
Bau und Anlage
Hier wird noch am Website-Schloss gebaut.
Geschichte
Hier wird noch am Website-Schloss gebaut.
Führungen / Familienprogramm
Hier wird noch am Website-Schloss gebaut.
Öffnungszeiten
Hier wird noch am Website-Schloss gebaut.
Eintrittspreise
Hier wird noch am Website-Schloss gebaut.
Anfahrt
Hier wird noch am Website-Schloss gebaut.
Kontakt
Hier wird noch am Website-Schloss gebaut.
Kloster Bronnbach
Die ehemalige Zisterzienserabtei Bronnbach aus dem 12. Jahrhundert befindet sich idyllisch gelegen im “Lieblichen Taubertal”, nahe Wertheim. Neben einer Abordnung der Kongregation der Missionare von der Heiligen Familie tragen heute noch zahlreiche andere Institutionen in der ehemaligen Zisterzienserabtei zur Belebung der Anlage bei. Vor allem in den letzten Jahren hat sich Kloster Bronnbach als beliebtes Ausflugs- und Urlaubsziel etabliert.
Bau und Anlage
Bronnbach gehört zu den ältesten und besterhaltenen Klosteranlagen des Zisterzienserordens in Süddeutschland. Die ursprüngliche Bausubstanz ist in vielen Teilen erhalten und die romanischen und gotischen Elemente dieses Baudenkmals wurden zu einem einzigartigen Ensemble zisterziensischer Baukunst verschmolzen. Neben den hochwertigen Zutaten aus der Zeit des Barocks prägen die Renovierungen der letzten Jahrzehnte durch moderne Architekturformen, die behutsam integriert und preisgekrönt wurden, die Anlage. In der Vielfalt der Baustile bildet der neu gestaltete Vorplatz der Kirche den Mittelpunkt des gesamten Baukomplexes.
Die Grundsteinlegung für die Klosterkirche erfolgte im Jahr 1157. Die dreischiffige Basilika mit Querhaus und gestaffeltem Chor verfügt heute über eine gerundete Apsis und quadratische Nebenapsiden, welche im Zuge eines Dachumbaus 1425 verändert und um 1700 auf den heutigen geraden Abschluss verkürzt wurden.
Im romanisch geprägten Bau der Klosterkirche mit steinernem Kreuzgratgewölbe beeindrucken die barocken Altäre im Mittelschiff und Querhaus, der Hochaltar von Baltasar Esterbauer und das von Daniel Aschauer kunstvoll geschnitzte Chorgestühl.
Es schließt sich der gotische Kreuzgang an, über den der romanische Kapitelsaal zu erreichen ist. Während des weiteren Rundgangs können auch der romanische Prälatensaal, die beiden barocken Säle, der Josephsaal und der Bernhardsaal, besichtigt werden.
Besonders sehenswert sind zudem die Gärten des Klosters, darunter der Kräutergarten, die barocken Gartenanlagen sowie die um 1775 errichtete Orangerie mit dem eindrucksvollen Außenfresko, das als das größte nördlich der Alpen gilt.
Geschichte
Das Kloster wurde 1153 als Mutterkloster von Maulbronn gegründet und gilt als Kulturdenkmal von nationaler Bedeutung.
1803 übernahm das Fürstenhaus Löwenstein-Wertheim-Rosenberg die gesamte Anlage. Seit 1986 ist das Klosterareal Eigentum des Main-Tauber-Kreises, der es Schritt für Schritt zum geistlich-wissenschaftlich-kulturellen Zentrum ausgebaut hat.
Führungen / Veranstaltungen
Das Kloster Bronnbach kann im Rahmen einer klassischen Klosterführung durch die romanische Klosterkirche mit barocken Altären und Chorgestühl, dem gotischen Kreuzgang und den prachtvollen barocken Festsälen erkundet werden. Aus einer ganzen Reihe unterschiedlicher Themen- und Sonderführungen zur Bau- und Ausstattungsgeschichte, Kindererlebnisführungen, kulinarischen Führungen zu den Themen Kräuter, Wein und Musik sowie Sonderführungen der Bronnbacher Institutionen kann gewählt werden. Das vielfältige Kunst- und Kulturprogramm wird erweitert durch unterschiedliche Wanderungen rund um die Klosteranlage oder Weinproben in der „Vinothek Taubertal“.
Besonders beliebt sind neben den Führungen, Wanderungen und Weinproben in der Vinothek die Veranstaltungen der BRONNBACHER KULTOUREN. Bronnbach bietet ein attraktives Kunst-und Kulturprogramm und setzt gezielt auf Qualität, Vielfalt und Ausgewogenheit. Unter verschiedenen Rubriken finden das ganze Jahr über abwechslungsreiche Veranstaltungen im stimmungsvollen Ambiente des Klosters statt: hochkarätige Konzerte, launiger Jazz oder die mehrtägige Kreuzgangserenade, dazu Seminare, Workshops, Vorträge, Ausstellungen und vieles mehr.
Öffnungszeiten
Klosterladen und Vinothek / Besichtigungszeiten Kloster
Mitte März bis Anfang November
Montag bis Samstag 10:00 bis 17:30 Uhr
Sonn- und Feiertag 11:30 bis 17:30 Uhr
Anfang November – Mitte März
Donnerstag von 11:00 bis 16:00 Uhr
Feste Führungszeiten
April bis Oktober
Dienstag bis Freitag 14:30 Uhr
Samstag 11:00 und 14:30 Uhr
Sonn- und Feiertag: 12:00 und 14:30 Uhr
Führungen sind täglich, auch außerhalb der Öffnungs- bzw. festen Führungszeiten, möglich.
Im Klosterladen sind Wertgutscheine für Veranstaltungen, Übernachtungen, Führungen und Wein erhältlich
Kontakt:
Tel. (09342) 935202020
Eintrittspreise
Bitte informieren Sie sich über die aktuellen Eintrittspreise auf der Seite von Kloster Bronnbach:
Anmeldung und Informationen zu den Führungen: Tel. (0 93 42) 9 35 20 20 01
Gastronomie/Übernachtung
Im besonderen Ambiente der historischen Klosteranlage sind Übernachtungen im modern ausgestatteten Gästehaus Bursariat möglich, ebenso stehen verschiedene Räumlichkeiten für Tagungen und Feierlichkeiten zur Verfügung.
Bei schönem Wetter ist der Biergarten im Saalgarten des Klosters Bronnbach von April bis Oktober von 11 bis 18 Uhr geöffnet.
Anfahrt
Mit dem Auto
Von Frankfurt kommend:
Auf der A 3 bis Ausfahrt Marktheidenfeld; Richtung Wertheim, von dort durch das “Liebliche Taubertal”
Von Würzburg kommend:
Auf der A 3 bis Ausfahrt Wertheim/Lengfurt; Richtung Wertheim, von dort durch das “Liebliche Taubertal” Richtung Tauberbischofsheim bis Bronnbach.
Von Stuttgart kommend:
Auf der A 81 bis Ausfahrt Tauberbischofsheim; Richtung Wertheim, von Werbach aus durch das “Liebliche Taubertal” bis Bronnbach.
Mit der Bahn
Mit dem ICE über Würzburg bzw. mit dem Regionalexpress von Stuttgart über Lauda.
Kloster Bronnbach hat eine eigene Haltestelle. Der Bahnhof befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite der Tauber (ca. 5 Minuten Fußweg zum Kloster).
http://www.kloster-bronnbach.de/showpage.php?Anfahrt&SiteID=15
Kontakt
Eigenbetrieb Kloster Bronnbach
Bronnbach 9
97877 Wertheim
Telefon: (0 93 42) 9 35 20 20 20
Fax: (0 93 42) 9 35 20 20 29
info(at)kloster-bronnbach.de
www.kloster-bronnbach.de
Schloss Weikersheim
Schloss und Schlossgarten Weikersheim gehören unbestritten zu den touristischen Juwelen in Baden-Württemberg. Eingebettet in die Ferienlandschaft Liebliches Taubertal bietet die ehemalige hohenlohesche Residenz Weikersheim mit ihrem wunderbaren Erhaltungszustand und dem an Figuren einzigartig reichen Park Höhepunkte der südwestdeutschen Renaissance- und Barockkunst.
Bau und Anlage
Berühmt sind der um 1600 entstandene Rittersaal, eine Meisterleistung der deutschen Renaissancebaukunst, die kostbare Barock-Ausstattung der Wohnräume und die einzigartige barocke Gartenanlage.
Geschichte
1586 verlegte Graf Wolfgang von Hohenlohe seinen Wohnsitz in die ehemalige Wasserburg und begann mit dem Ausbau des neuen Schlosses. auf dem Grundriss eines gleichseitigen Dreiecks entstand ein Renaissanceschloss, das auch schon barocke Ansätze in sich trug. Einen Höhepunkt der südwestdeutschen Renaissancebaukunst stellt der um 1600 entstandene, reich dekorierte RITTERSAAL dar. Er ist einer der am besten erhaltenen Festsäle der Zeit. Berühmt ist die weit gespannte Saaldecke, vor allem wegen ihrer mit farbenfrohen Jagdszenen gefüllten Kassetten. LUSTGARTEN MIT ZWERGENGALERIE Als Graf Carl Ludwig von Hohenlohe (1674-1756) Anfang des 18. Jahrhunderts die Residenz übernahm und hier über 50 Jahre wirkte, erhielten Schloss und Park nahzu die Gestalt, in der sie noch heute erhalten sind. Der Lustgarten des Schlosses wurde angelegt und erhielt einen krönenden und harmonischen Abschluss durch die Orangerie, die den Garten wie ein Theaterkulisse begrenzt. Herausragendes Merkmal des Parks ist die Vielzahl barocker Figuren, mit denen der Garten bevölkert ist. Berühmt sind insbesondere die “Weikersheimer Zwerge”: Graf Carl Ludwig ließ hier Teile seines Hofstaats als Zwergengalerie verewigen. Zu den grotesken Wesen am Rand der Gartenanlage gesellen sich im Parterre Figuren antiker Götter wie Apollo und Diana, dazu Planeten wie Merkur, Saturn, Venus oder Mars sowie Darstellungen der Jahreszeiten und der Elemente.
Führungen / Familienprogramm
Schlossbesichtigung Ganz klassisch ist ein Besuch in den gräflichen Räumen des Weikersheimer Schlosses – eine Zeitreise durch die glanzvollen Epochen von Renaissance und Barock in Hohenlohe. Schon beim Betreten des stimmungsvollen Weikersheimer Schlosshofes taucht man ein in eine ganz andere Welt, fernab vom heutigen Alltag. Der Rundgang durch die prachtvollen barocken Wohnungen der Hohenloher-Herrscherfamilie macht bekannt mit der Entstehungsgeschichte der traditionsreichen Residenz und den historischen Entwicklungen in der Region. Farbige Geschichten und Anekdoten lassen die einstigen Bewohner des Schlosses und ihre Hofhaltung lebendig erstehen. Fast so schön, als wäre man Gast der gräflichen Familie. Schlossgarten ganzjährig geöffnet Der Weikersheimer Schlossgarten weist die für Gärten des Barock typische Dreiteilung in Lust-, Nutz- und Baumgarten auf. Die Anlage ist streng symmetrisch. Ihr liegt ein großes Achsenkreuz zugrunde. Die Breite der Mittelachse orientiert sich am Saaltrakt des Schlosses mit der vorgelagerten Terrasse. Von der künstlerischen Sinngebung des Gartens als einem zweiten Paradies auf Erden erzählen die fantasievollen Wasserspiele, der reiche Skulpturenschmuck und seltene Orangeriepflanzen. Sie sollen die Schönheit und Einzigartigkeit des Platzes hervorheben. Nach außen wird das Gelände von einer Mauer begrenzt, deren südliche Ecken zwei Pavillons akzentuieren. Die Mauer bildet die Trennlinie zwischen dem geordneten Paradies und der ungezähmten Natur außerhalb.
Sonderführung, Themen- und Kostümführungen laut Programm und nach Vereinbarung
Regelmäßige Veranstaltungen
Standartführungen durch die historischen Wohnräume des Schlosses Weikersheim finden für Einzelpersonen stündlich statt. Gruppenführungen nach Vereinbarung. Sonderführungsprogramm und Veranstaltungen für Erwachsene und Kinder siehe www.schloss-weikersheim.de unter Führungen und Veranstaltungen.
Öffnungszeiten
1. April – 31. Oktober
Mo. – So. 9:00 – 18:00 Uhr
1. November – 31. März
Mo. – So. 10:00 – 12:00 Uhr, 13:00 – 17:00 Uhr
24.12. geschlossen 31.12. geschlossen
Dauerausstellungen:
„Alchemie in Schloss Weikersheim“ vom 1. April – 31. Oktober geöffnet
„Wasserkunst & Götterreigen“ Besichtigung während der regulären Öffnungszeiten möglich
„Allerhand Zierrathen“ Besichtigung nur im Anschluss an eine Schlossführung möglich
Eintrittspreise
SCHLOSS
Erwachsene: 6,00 €
Ermäßigte: 3,00 €
Gruppen ab 20 Pers.: 5,40 €
Gruppen unter 20 Pers.
Familien: 108,00 € 15,00 € (Schlossgarten und Dauerausstellung inbegriffen)
SCHLOSSGARTEN SOMMER Sommerpreise (01.04. – 31.10):
Erwachsene: 3,00 €
Ermäßigte: 1,50 €
Gruppen ab 20 Pers.: 2,50 €
Familien: 7,50 €
SCHLOSSGARTEN WINTER Winterpreise (01.1. – 31.03.):
Erwachsene: 2,00 €
Ermäßigte: 1,00 €
Gruppen ab 20 Pers.: 1.50 €
Familien: 5,00 €
Anfahrt
Mit dem Auto:
Parkplätze für PKW: Heiliges Wöhr
kostenfreie PKW- und Busparkplätze: Parkplatz Tauberwiese
Mit dem Fahrrad:
Direkt am Radweg “Liebliches Taubertal” und Romantische Straße
Abstellmöglichkeiten direkt vor dem Schloss vorhanden.
Laden von Akkus für eBikes möglich.
Mit dem ÖPNV:
Bahnlinie Lauda-Crailsheim Der Bahnhof Weikersheim liegt 5 Gehminuten vom Schloss entfernt.
Buslinie Craislheim – Bad Mergentheim – Fahrplanauskunft: www.3-loewen-takt.de
Kontakt
Schloss und Schlossgarten Weikersheim
Marktplatz 11
97990 Weikersheim
Telefon +49(0)79 34.9 92 95-0
Telefax +49(0)79 34.9 92 95-12
info(at)schloss-weikersheim.de
www.schloss-weikersheim.de
Museum “Schlösschen im Hofgarten”, Wertheim
Das in einem Park gelegene Museum beherbergt die Sammlungen der Stiftung Schlösschen im Hofgarten mit Werken der Berliner Secession, französischem Porzellan und Gemälden der Romantik. Diese werden in wechselnder Auswahl und in Verbindung mit Sonderausstellungen gezeigt.
Bau und Anlage
In etwa 10 Gehminuten Entfernung von Altstadt und Grafschaftsmuseum liegt am Ortseingang von Wertheim das Museum „Schlösschen im Hofgarten“, umgeben von einem englischen Landschaftsgarten. Es beherbergt heute drei herausragende Kunstsammlungen: „Gemälde und Aquarelle der Berliner Secession“ (ehem. Stiftung Wolfgang Schuller) umfasst außer den führenden deutschen Impressionisten Max Liebermann, Lovis Corinth, Max Slevogt und Fritz v. Uhde auch Gemälde der herausragenden Berliner Maler Hans Baluschek, Walter Leistikow, Lesser Ury und Heinrich Zille. Die Sammlung „Maler des 19. Jahrhunderts aus dem Rhein-Main-Neckar-Raum“ umfasst u.a. Gemälde der Romantik und des malerischen Realismus von Carl Rottmann, Theodor Verhas und Bernhard Fries. Die Privatsammlung „Porcelaine de Paris“ zeigt eine wechselnde Auswahl an Porzellanen von Dagoty, Darte, Sévres und anderen französischen Manufakturen aus der napoleonischen Zeit. Aus diesen Sammlungen ist neben den Sonderausstellungen stets eine Auswahl zu sehen.
Geschichte
Das sanierte Kleinod aus dem Jahr 1777 war einst Sommerhaus des Grafen Friedrich Ludwig von Löwenstein-Wertheim-Virneburg. Der um 1814/16 angelegte Park mit Rundtempel, einem so genannten „Hungerdenkmal“ und anderen Elementen englischer Gartenarchitektur erstreckte sich ursprünglich bis zur Wertheim Burg und wurde nach historischen Plänen wiederhergestellt.
Führungen
Führungen durch Museum, Sonderausstellungen und Park sowie Veranstaltungen im Saal der ehemaligen Orangerie werden angeboten. Der Raum kann auch für Feierlichkeiten gemietet werden. Im Park befindet sich auch das Café Sahnehäubchen.
Regelmäßige Veranstaltungen
Konzerte und Lesungen – Programm s. Website
Öffnungszeiten
Öffnungszeiten November – März
Fr – Sa 14 – 17 Uhr
So, Fei 12 – 18 Uhr
Öffnungszeiten April – Oktober
Di – Sa 14 – 17 Uhr
So, Fei 12 – 18 Uhr
(24.12.,31.12. geschlossen)
Eintrittspreise
3,50 / erm. 2,- / Führungspauschale 50,- zzgl. 3,- p. Person
Anfahrt
Würzburger Str. 30
An der L 2310 gelegen
Parkplatz gegenüber
Kontakt
Museum „Schlösschen im Hofgarten“
Würzburger Str. 30
97877 Wertheim-Eichel
Post und Kontaktadresse
c/o Grafschaftsmuseum (Tel. 09342 /301 511)
Museum-schloesschen@wertheim-main.de
Führungen nach Vereinbarung auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich.